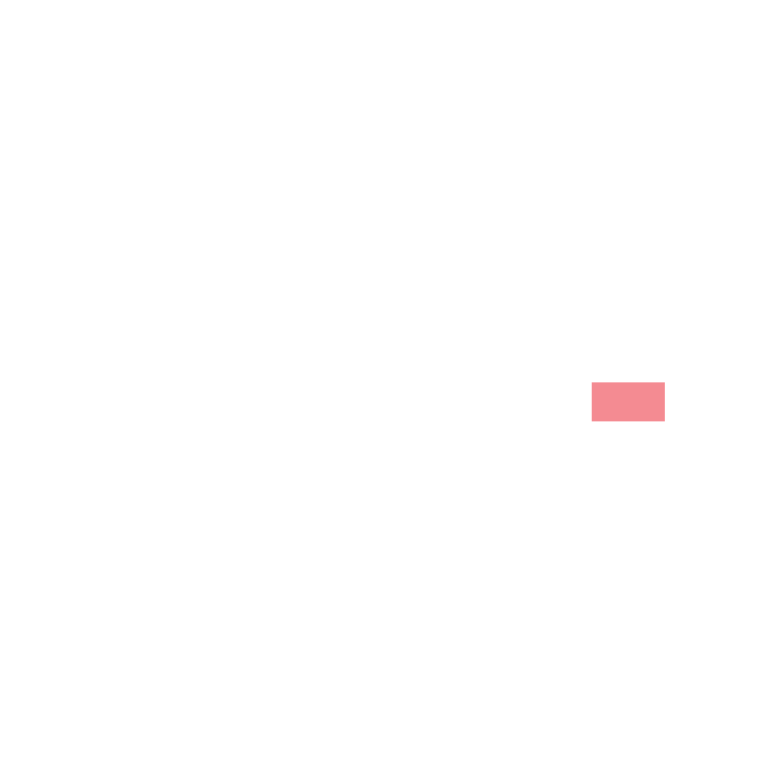2. Dezember 2020
Fokus Sicherheit: SPI geht Kooperation mit GCSP und SVS ein
Das SPI wird in Fragen der Weiterbildung im Bereich der öffentlichen Sicherheit künftig mit dem Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik (GCSP) und dem Sicherheitsverbund Schweiz (SVS) zusammenarbeiten. Damit gelingt ein wichtiger Schritt zur verbesserten Vernetzung der nationalen Sicherheitsorgane. Die entsprechende Vereinbarung wurde Ende Oktober von allen Vertragspartnern unterzeichnet und tritt per 1. Januar 2021 in Kraft.
Überall auf der Welt stehen Sicherheitsakteure in zunehmend globalisierten und urbanisierten Gesellschaften vor neuen Herausforderungen. Angesichts einer immer breiteren Palette von Bedrohungen und einer sich rasant weiterentwickelnden Technologie gilt es zu verstehen, was auf dem Spiel steht. Es gilt, den Überblick zu behalten und vernetzt zu handeln. Weiterbildung ist unerlässlicher denn je, um mit den Erwartungen Schritt zu halten. Die Schweiz ist von dieser Entwicklung nicht ausgenommen.
Die Sicherheitsakteure in diesem Land müssen daher ihre Sichtweise erweitern, die Sicherheit über ihren alltäglichen Horizont hinaus verstehen. Sicherheit ist mehrdimensional und basiert auf Risiken, die vielschichtig sind und sich in Raum und Zeit verändern.
 Mit der neuen Kooperation erhalten die höheren Polizeikader die Gelegenheit, ihre bereits ausgezeichneten Fähigkeiten und ihre mehrjährige Einsatzerfahrung in Sicherheitsfragen um wichtige Elemente des globalen und interdisziplinären Ansatzes zu erweitern. Dazu Stefan Blättler, Stiftungsratspräsident des SPI: «Die Führung und die Funktionsweise unseres Landes im Krisenfall zu kennen, ist elementar, um die Interaktionen zwischen den verschiedenen Krisenmanagementorganen des öffentlichen und privaten Sektors zu verstehen.» Die Kader sollen dadurch noch besser befähigt werden, ihre Effektivität in der Problemerfassung und Lagebeurteilung zu steigern und sich auf die mögliche Übernahme von Entscheidungspositionen in ihren Institutionen vorzubereiten.
Mit der neuen Kooperation erhalten die höheren Polizeikader die Gelegenheit, ihre bereits ausgezeichneten Fähigkeiten und ihre mehrjährige Einsatzerfahrung in Sicherheitsfragen um wichtige Elemente des globalen und interdisziplinären Ansatzes zu erweitern. Dazu Stefan Blättler, Stiftungsratspräsident des SPI: «Die Führung und die Funktionsweise unseres Landes im Krisenfall zu kennen, ist elementar, um die Interaktionen zwischen den verschiedenen Krisenmanagementorganen des öffentlichen und privaten Sektors zu verstehen.» Die Kader sollen dadurch noch besser befähigt werden, ihre Effektivität in der Problemerfassung und Lagebeurteilung zu steigern und sich auf die mögliche Übernahme von Entscheidungspositionen in ihren Institutionen vorzubereiten.
Blättler ist überzeugt, dass damit ein ganz wichtiger «Stein ins Rollen» gebracht wurde. Denn für die Bewältigung einer Krise sei die Vorbereitung lange vor Krisenbeginn entscheidend: «Es muss uns gelingen, eine eingespielte Krisenorganisation über alle föderalen Stufen und Strukturen hinweg und mit fachlich neutralem Blick zu etablieren. Die permanente Vernetzung der Organisationen für den Krisenfall muss ausgebaut werden.»
Christian Dussey, Direktor des GCSP, begrüsst den starken Vernetzungscharakter dieser neuen Kooperation: «Durch die Zusammenarbeit werden neue Kontakte geknüpft, ein verstärkter Austausch sowie der Zugang zu wertvoller Expertise und Wissen für das GCSP ermöglicht.» André Duvillard, Delegierter des SVS, ist überzeugt, dass die heutigen Sicherheitsfragen vernetzt anzugehen sind: «Führungskräfte des Sicherheitsverbunds müssen mit der Rolle und den Fähigkeiten der verschiedenen Organisationen, aus denen er sich zusammensetzt, vertraut sein.»
Gleichzeitig wurde im Rahmen der Vereinbarung der strategische Fachauschuss für die kontinuerliche Weiterentwicklung der Programme konstituiert. Er besteht aus den folgenden Vertretern:
- Stefan Aegerter, Vizedirektor SPI, Leiter Geschäftsbereich Aus- und Weiterbildung
- Roland Favre, Divisionär, delegierter Höherer Stabsoffizier des VBS am GCSP
- André Duvillard, Delegierter SVS
Lehrgänge für höhere Kader des Sicherheitsverbundes Schweiz (LG SVS I/2022 und II/2022)
Lesen Sie nachfolgend die Antworten von Stefan Blättler, Christian Dussey und André Duvillard auf einige Fragenkomplexe zur neu geschaffenen Kooperation:
Fragen an den Präsidenten des Stiftungsrates des SPI (Stefan Blättler)
 Was erwarten Sie von diesen Weiterbildungskursen für die höchsten Polizeikader des Landes?
Was erwarten Sie von diesen Weiterbildungskursen für die höchsten Polizeikader des Landes?
Unsere höheren Polizeikader verfügen über ausgezeichnete Fähigkeiten und mehrjährige Einsatzerfahrung. Das föderale System der Schweiz mit seinen verteilten Verantwortlichkeiten und Kompetenzen ist jedoch komplex und die Strukturen teilweise kompliziert. Mit dem Weiterbildungsangebot des Genfer Zentrums für Sicherheitspolitik wird der globale und interdisziplinäre Ansatz für Sicherheitsfragen in der Schweiz um wichtige Elemente erweitert. Die Führung und die Funktionsweise unseres Landes im Krisenfall zu kennen, ist elementar, um die Interaktionen zwischen den verschiedenen Krisenmanagementorganen des öffentlichen und privaten Sektors zu verstehen. Von der Erweiterung und Vertiefung dieser Kenntnisse profitieren wiederum die Polizeikorps.
Welche konkreten Zielsetzungen verfolgen Sie durch diese Vereinbarung? Welches sind Ihre Erwartungen an das GCSP?
Der Aufbau und die Weiterentwicklung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Netzwerken sind wichtiger denn je. Wir erwarten natürlich, dass die künftigen Absolventen/-innen dieser Weiterbildungen vom gegenseitigen Austausch zwischen den Teilnehmern/-innen einerseits und den hervorragenden Dozierenden andererseits profitieren. Sie sollen befähigt werden, ihre Effektivität in der Problemerfassung und Lagebeurteilung zu steigern und sich auf die mögliche Übernahme von Entscheidungspositionen in ihren Institutionen vorzubereiten.
Gleichzeitig erhoffen wir uns im Bereich der Wissensvermittlung, dass die neuesten Erkenntnisse über Lehr- und Lernformen auch für unser Bildungsangebot des SPI interessant sind und wir gegenseitig lernen können. Denn auch hier gilt das Motto «in der Krise Köpfe kennen».
Welches sind aus Ihrer Sicht die grössten sicherheitspolitischen Herausforderungen, denen unser Land im kommenden Jahrzehnt gegenübersteht? Inwieweit kann eine solche Kooperationsvereinbarung und die angebotenen Lehrgänge dazu beitragen, die Widerstandsfähigkeit der inneren Sicherheit der Schweiz angesichts der Vielfalt neuer Bedrohungen zu stärken?
Die Bewältigung einer Krise beginnt lange bevor sie ausbricht. Die Vorbereitungen sind entscheidend. Welche strukturellen Stärken – aber auch Chancen und Schwächen – weist das Risiko- und Krisenmanagement der Schweiz auf? Wie können Mängel in der Vorbereitung und der Bewältigung von Krisen generell minimiert werden? Es muss uns gelingen, eine eingespielte Krisenorganisation über alle föderalen Stufen und Strukturen hinweg und mit fachlich neutralem Blick zu etablieren. Die permanente Vernetzung der Organisationen für den Krisenfall muss ausgebaut werden. Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser Kooperation einen «Stein ins Rollen» bringen. Das Produkt «Sicherheit» verdient es, dass wir uns gerade auch in der Aus- und Weiterbildung noch besser vernetzen.
Fragen an den Direktor des GCSP (Christian Dussey)
 Als international anerkanntes Weiterbildungszentrum, soll das GCSP auch als eine Plattform für Reflexion und Dialog über die wichtigsten aktuellen sicherheitspolitischen Themen der Schweiz fungieren. Weshalb haben Sie in diesem Kontext beschlossen, Lehrgänge für die höchsten Kader der inneren Sicherheit der Schweiz anzubieten? Ist es die Aufgabe des GCSP, ein Akteur auf dem Gebiet der Weiterbildung in unserem Land zu werden?
Als international anerkanntes Weiterbildungszentrum, soll das GCSP auch als eine Plattform für Reflexion und Dialog über die wichtigsten aktuellen sicherheitspolitischen Themen der Schweiz fungieren. Weshalb haben Sie in diesem Kontext beschlossen, Lehrgänge für die höchsten Kader der inneren Sicherheit der Schweiz anzubieten? Ist es die Aufgabe des GCSP, ein Akteur auf dem Gebiet der Weiterbildung in unserem Land zu werden?
Das GCSP wurde 1995 auf Initiative von Alt-Bundesrat Adolf Ogi gegründet. Als Beitrag der Schweiz zu Frieden und Sicherheit stellt das Zentrum seit 25 Jahren Entscheidungsträgern in aller Welt die Instrumente zur Verfügung, die sie benötigen, um die Komplexität strategischer und internationaler Fragen besser zu verstehen und zu bewältigen. Das GCSP wurde auf der Grundlage eines inzwischen denkwürdigen Ausbildungskurses namens «SIPOLEX» gegründet. Dieses unmittelbar nach dem Genfer Gipfel von 1985, dem ersten Treffen zwischen US-Präsident Ronald Reagan und dem sowjetischen Generalsekretär Michail Gorbatschow, ins Leben gerufene 8-monatige Ausbildungsprogramm sollte die Kompetenzen des EMD (heute VBS) und des EDA in den Bereichen Abrüstung und internationale Sicherheit rasch fördern. Es ist daher nur natürlich, dass das GCSP zu seinen Wurzeln zurückkehrt und seine Zusammenarbeit mit den Sicherheitsakteuren in der Schweiz verstärkt. Die zunehmenden Unsicherheiten und die Verwundbarkeit der Gesellschaft gegenüber aktuellen und potenziellen Risiken und Bedrohungen (Pandemien, Cyberangriffe, Terroranschläge usw.) zwingen uns, die Fähigkeiten für Antizipation, Flexibilität und Resilienz im Inland umgehend zu stärken.
Was erwarten Sie von diesen Lehrgängen? Welches sind die Zielgruppen, die Sie mit diesem Ausbildungsangebot erreichen wollen?
In erster Linie müssen wir aus den «Silos» herauskommen. Sicherheitsbelange in diesem Land betreffen nicht nur die öffentliche Hand sowie die mit ihr verbundenen Organisationen und Akteure, sondern der Privatsektor übernimmt ebenfalls wichtige Sicherheitsaufgaben. Diese werden manchmal übersehen, oft unterschätzt und sind dennoch von wesentlicher Bedeutung für die Kohärenz der Sicherheitsarchitektur der Schweiz. Diese Lehrgänge, die sich an Führungskräfte richten, bieten jeder und jedem die Möglichkeit, die Kenntnisse im Sicherheitsbereich weiter zu vertiefen, aber auch das persönliche Beziehungsnetz in einem Land zu erweitern, in dem sich die Sicherheitsakteure noch zu wenig kennen und miteinander sprechen.
Welchen Mehrwert bringt diese Kooperationsvereinbarung mit dem Schweizerischen Polizei-Institut für das GCSP im Allgemeinen und für diese Lehrgänge im Besonderen?
Diese Vereinbarung schafft eine direkte Verbindung zu einem wichtigen Akteur im Bereich der inneren Sicherheit des Landes, der Polizei. Durch die Zusammenarbeit werden neue Kontakte geknüpft, ein verstärkter Austausch sowie der Zugang zu wertvoller Expertise und Wissen für das GCSP ermöglicht. Sie wird auch dazu beitragen, das GCSP innerhalb der Landesgrenzen, insbesondere in der Deutschschweiz, besser bekannt zu machen und sich dort durch die Organisation bestimmter Events oder ganzer Kursmodule zu etablieren. Diese Partnerschaft wird eine Bereicherung für unsere Lehrgänge sein und zugleich sicherstellen, dass eine angemessene Vertretung des Polizeikaders an der Weiterbildung teilnehmen wird.
Fragen an den Delegierten des Bundes und der Kantone für den SVS (André Duvillard)
 Währenddem es im Bereich Sicherheit in der Schweiz bereits ein breites Angebot an Weiterbildungskursen gibt, warum haben Sie sich diesem neuen Ausbildungsangebot angeschlossen? Welchen Bedarf deckt es ab?
Währenddem es im Bereich Sicherheit in der Schweiz bereits ein breites Angebot an Weiterbildungskursen gibt, warum haben Sie sich diesem neuen Ausbildungsangebot angeschlossen? Welchen Bedarf deckt es ab?
Es stimmt, dass die verschiedenen Sicherheitsorganisationen eine breite Palette von Ausbildungskursen anbieten, sei es im Technischen, Taktischen oder sogar in der Bewältigung bestimmter Ereignisse. Aber die heutigen Sicherheitsfragen müssen vernetzt angegangen werden, was bedeutet, dass Führungskräfte des Sicherheitsverbunds mit der Rolle und den Fähigkeiten der verschiedenen Organisationen, aus denen er sich zusammensetzt, vertraut sein müssen. Der beste Weg, dieses Ziel zu erreichen, besteht natürlich darin, diese Art von Ausbildung unter einem Dach zusammenzuführen, so dass der ganzheitliche Ansatz nicht nur in Bezug auf den Inhalt der Ausbildung, sondern auch in Bezug auf die Teilnehmer Wirklichkeit wird.
Sind Ihrer Meinung nach die festgestellten Mängel bzw. der Handlungsbedarf in erster Linie auf eine mangelnde Ausbildung oder vielmehr auf eine mangelnde Vernetzung der Sicherheitsakteure in der Schweiz zurückzuführen?
Meiner Ansicht nach sind die festgestellten Mängel in erster Linie das Ergebnis einer mangelnden Vernetzung. Während viele Länder bereits einen solchen Ansatz gewählt haben, hat die Schweiz lange Zeit einen «Silo»-Ansatz favorisiert, was sicherlich auch auf unsere föderalistischen Strukturen und auf die verfassungsrechtliche Kompetenzordnung (Trennung zwischen Bund und Kantonen) zurückzuführen ist. Das Konzept des Sicherheitsverbunds wurde im Sicherheitspolitischen Bericht 2010 konkretisiert, und es ist nur konsequent logisch, dass es auch im Bereich der Ausbildung umgesetzt wird sollte, auch wenn dies erst neun Jahre später geschieht.
Welche Trümpfe bzw. Stärken hat das GCSP, um zur Effizienz des SVS beizutragen? Wie könnte das GCSP diese Stärken in Zukunft zum Wohle der inneren Sicherheit der Schweiz noch besser nutzen?
Das GCSP wurde vor 25 Jahren auf Initiative der Schweizerischen Eidgenossenschaft gegründet und organisiert Ausbildungskurse im Bereich der internationalen Friedens- und Sicherheitspolitik. Im Ergebnis bringt es eine Vision von Themen mit sich, die über die Grenzen unseres Landes hinausgeht. Diese Aspekte sind auch wichtig, wenn wir uns mit Fragen der inneren Sicherheit befassen. Ich würde sogar sagen, dass sie sich gegenseitig ergänzen. Die Krise, die wir gerade durchmachen, ist das beste Beispiel dafür. Die Grenze zwischen innerer und äusserer Sicherheit ist in einer globalisierten Welt extrem verwischt. Daher ist die formalisierte Zusammenarbeit zwischen diesen drei Entitäten – des GCSP, dem SVS und dem SPI – ein perfektes Beispiel für den vernetzten Ansatz, den wir verfolgen müssen, um den heutigen Sicherheitsherausforderungen zu begegnen.