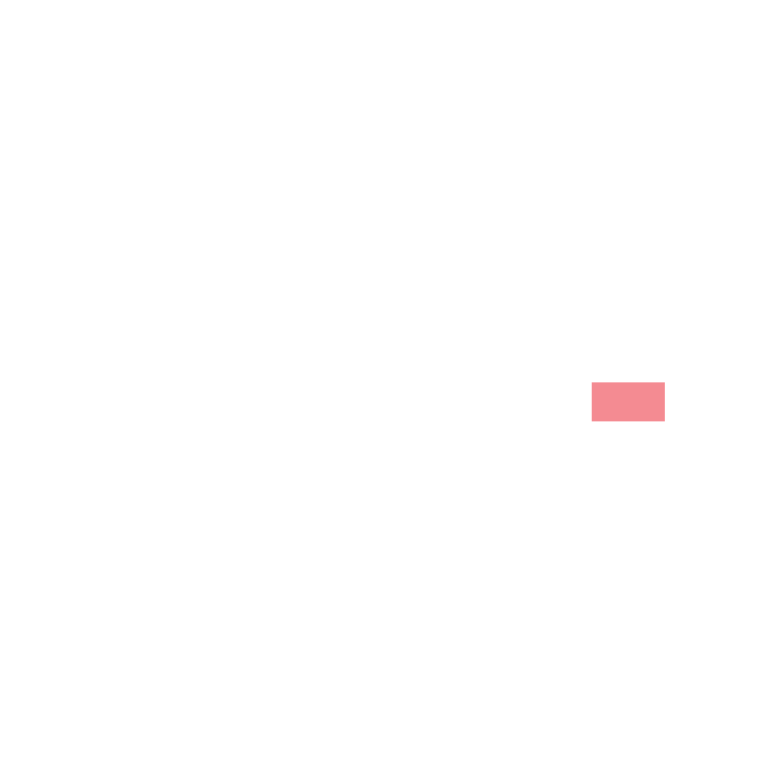15. Juni 2021
Informationstagung für die Kursdirektionen: Corona als Katalysator
Die diesjährige Informationstagung für die Kursdirektionen des SPI reflektierte die Erfahrungen und Lehren im Umgang mit der Coronakrise. Ausserdem setzte sie sich mit den Möglichkeiten und Grenzen des Fernunterrichts auseinander und wagte einen Blick in die Zukunft des Rollenbilds von Instruktoren/-innen.
 Unmittelbare Auswirkungen von Corona
Unmittelbare Auswirkungen von Corona
Die Coronakrise fordert den Bereich «Lehrgänge und Kurse» des SPI nun schon seit geraumer Zeit immer wieder aus Neue. Es gilt, sich auf ständig wechselnde Rahmenbedingungen einzustellen und jeden einzelnen Kurs und Lehrgang auf seine Durchführbarkeit hin zu überprüfen. Regelmässige Lagerapporte unterstützen eine flexiblere Planung der Veranstaltungen. Problemerfassung, Lagebeurteilung, Entschluss: Das ist der Ablauf für jede einzelne Veranstaltung. Die Umsetzung der Führungsgrundlagen aus den Kaderausbildungen des SPI hat sich in der Praxis bestens bewährt.
Konkret verschob das SPI 122 für das Frühjahr 2020 geplante, bestätigte Kurse und Lehrgänge in den Herbst 2020 und das Jahr 2021. Trotz Corona wurde alles darangesetzt, den Polizeikorps genügend Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Viele Kursveranstaltungen werden daher 2021 doppelt angeboten.
Reflexionen zum Umgang mit Corona
Ein erstes Ziel der diesjährigen Informationstagung für die Kursdirektionen des SPI war es deshalb, den Umgang mit der Coronakrise kritisch zu beleuchten. Es galt, aus Erkenntnissen, getroffenen Massnahmen und den gemachten Erfahrungen erste Lehren zu ziehen, wie sich die SPI-Kurse und -Lehrgänge in optimaler Weise an neue Gegebenheiten und Rahmenbedingungen anpassen lassen. Dazu Stefan Aegerter, Bereichsleiter Aus- und Weiterbildung und Direktor ad interim des SPI: «Krisen und ausserordentliche Lagen führen zu Veränderung; sie sind ein Katalysator für Erneuerung und Innovation.» Der Bruch mit Routinen in praktisch allen Bereichen des Alltags zwang auch das SPI, Rahmenbedingungen und Abläufe zu hinterfragen.
Insbesondere ging es darum, inwiefern sich die Kurse des SPI für den Fernunterricht eignen und was es bei dieser Überprüfung zu beachten gilt. Denn während Polizeiarbeit sich immer am Grundsatz «von Menschen für Menschen» ausrichtet, stellt das digitale Lernen sowohl an die Kursleiter/-innen als auch an die Teilnehmenden verschiedene Herausforderungen.
Fernunterricht als logische Konsequenz?
Anojen Kanagasingam, Stellvertreter des Bereichsleiters und verantwortlich für den Teilbereich Prüfungen und Zertifizierungen, führte die lebhafte Diskussion mit den Kursdirektoren/-innen. Darin wurden mehrere Faktoren für die erfolgreiche Durchführung eines Kurses oder Lehrgangs im Fernunterricht identifiziert. Gerade das Bildungsangebot des SPI basiere auf einer hohen Interaktivität zwischen Ausbildern/-innen und Auszubildenden. Viele Kurse leben vor allem von den Gruppenarbeiten, die virtuell schwierig durchzuführen sind. Ein weiteres wesentliches Manko von Fernunterricht sei, dass die unmittelbaren Reaktionen der einzelnen Teilnehmenden jeweils nur sehr beschränkt zu sehen seien. Dies erschwere dem/der Kursleiter/-in die optimale Anpassung des Kurses an die unmittelbaren Bedürfnisse der Teilnehmenden.
Der virtuellen Durchführung müsse deshalb ein sorgfältiger didaktischer und methodologischer Umbau des Kurses oder Lehrgangs vorausgehen, der sich an den technischen Möglichkeiten, Herausforderungen und Grenzen orientiert. Um das Delta zu einer Durchführung via Präsenzunterricht auszugleichen, sei umso mehr Kreativität gefragt. Deshalb sei es wichtig, dass der Kursdirektion hierbei auch erfahrene Spezialisten/-innen beistünden.
Unverzichtbare menschliche Interaktion
Last but not least komme den Kursen und Lehrgängen eine weitere ganz wesentliche Aufgabe zu, nämlich die des organischen Entstehens von Netzwerken unter den Teilnehmenden – darin war in der Diskussion ein starker Konsens auszumachen. Es sei also alles daran zu setzen, Möglichkeiten zu finden, um das Manko des fehlenden direkten formellen sowie informellen Austauschs in virtuellen Kursen und Lehrgängen weitgehend zu kompensieren. Als die wohl geeignetste Form wurde eine hybride Durchführungsform beurteilt, in der ein Teil des Kurses oder Lehrgangs virtuell und ein Teil kompakt in Präsenz stattfindet. Aus der Kombination beider Formen könne ein optimales Lernerlebnis erzielt werden und gleichzeitig auch die wertvolle Vernetzung der Teilnehmenden stattfinden.
In seinem Schlusswort fasste Stefan Aegerter die Diskussion über die künftige Art und Weise der Durchführung von Lehrgängen und Kursen zusammen. Eine Tendenz zeichne sich klar ab: Der persönliche Austausch könne und solle weitestgehend nicht virtuell stattfinden, sondern auch weiterhin durch Präsenzunterricht gewährleistet sein. Prioritär gehe es also darum, digital zu unterstützen und zu optimieren, auch bezüglich der Kursunterlagen. Zudem gelte es, das bewährte Milizsystem bestmöglich zu unterstützen und nicht um der reinen Digitalisierung willen zu überlasten. Die Diskussion sei lanciert, stehe aber erst ganz am Anfang. Man werde den Weg gemeinsam beschreiten und sich den Fragen der Zukunft stellen.
Science-Fiction oder baldige Realität?
In einem Inputreferat skizzierte Dilini Jeanneret, Bereichsleiterin Bildungsmedien am SPI, die Tendenzen in der zukünftigen Entwicklung der Rolle und Aufgabe von Lehrpersonen und Ausbildenden. Sie konzentrierte sich dabei auf wissenschaftliche Erkenntnisse im Bereich der Berufsbildung in der Schweiz, gestützt auf die Visionen des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) im Rahmen des umfangreichen Projekts «Berufsbildung 2030». In einer immer komplexeren Welt, in der die Zukunft ungewiss scheint, werde vor allem die Fähigkeit zur Agilität zu einem zentralen Gut. Dabei gehe Agilität aber stark mit Kompetenz einher. Diese vor mehr als zehn Jahren eingeführte Kompetenzorientierung in der Berufsbildung in der Schweiz ziele darauf ab, die Menschen so auszubilden, dass sie auf die neuen Anforderungen des Arbeitsmarktes und seine Organisation vorbereitet seien. Sie sollen lernen, in allen Situationen agil zu sein und sich schnell an neue Situationen anzupassen – insbesondere im Berufsalltag (Seufert, S. (2018). Flexibilisierung der Berufsbildung im Kontext fortschreitender Digitalisierung. Bern: SBFI.).
Geführtes, individuelles Lernen zu fördern werde in naher Zukunft essenziell für den Lernerfolg und führt die gegenwärtigen Paradigmenwechsel vor Augen. Demnach vermitteln Lehrpersonen oder Ausbildende nicht «nur» ihr Wissen, sondern begleiten die Auszubildenden in ihrem Prozess der Wissensaneignung. Sie werden somit immer mehr zu Mentoren/-innen und Coaches. Die Kompetenzorientierung ist ein weiterer wichtiger Trend, der bis 2030 zur Norm werden dürfte.
Modell Mensch mit Zukunft
Eine Kombination aus «analogem» und «digitalem» Lernraum ermögliche in Zukunft einerseits den persönlichen wie auch virtuellen Austausch unter allen Anspruchsgruppen und trete andererseits als Wissens- und Kompetenzzentrum für Bildung auf. Konkret bedeute dies, dass es neue pädagogische Konzepte und «Digital Leadership» brauche. Es bedeute aber auch, dass neue Kompetenzen erforderlich seien, um die Chancen und Risiken einer fortgeschrittenen Digitalisierung zu verstehen und gestalterisch wirken zu können. Es brauche neue Rahmenbedingungen, um den erforderlichen Kulturwandel und eine stärkere Selbstorganisation in den Bildungsinstitutionen zu unterstützen.
«Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die berufliche Bildung nicht nur auf die Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten beschränkt, sondern auch Haltungen stiftet und die eigene Offenheit, Flexibilität und Wirksamkeit im gestaltenden Umgang mit neuen Anforderungen verbessert», so Dilini Jeanneret. Neben der fachlichen Kompetenzentwicklung stehe zunehmend die Stärkung der «Persönlichkeiten» der Auszubildenden im Vordergrund. Komplementäre Kompetenzen zu (intelligenten) Maschinen und digitalen Systemen wie etwa Kreativität, kritisches Denken, Erfindungsgeist oder Empathie werden an Bedeutung gewinnen (Seufert, S. (2018). Flexibilisierung der Berufsbildung im Kontext fortschreitender Digitalisierung. Bern: SBFI.).