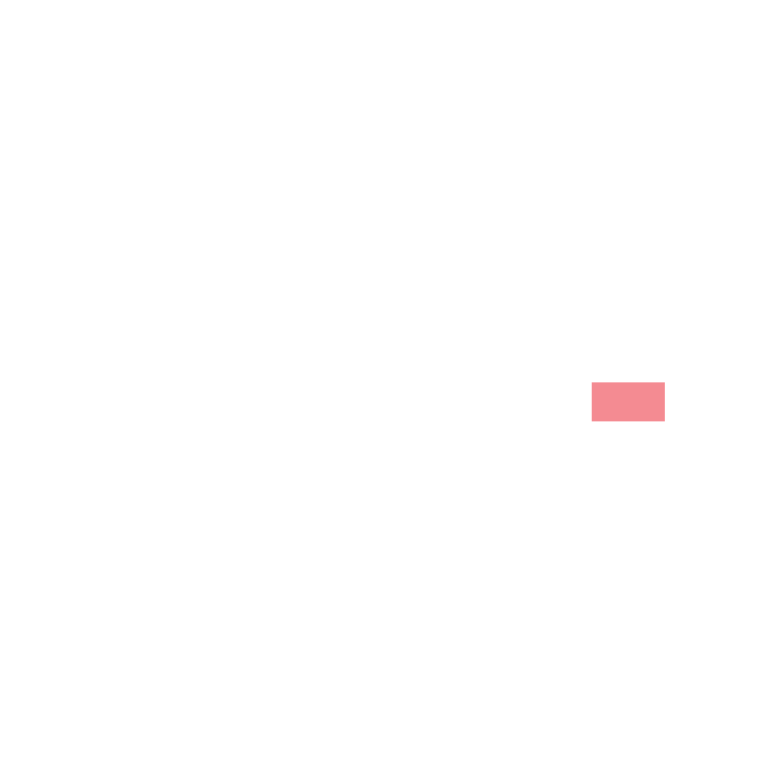26. August 2022
«Just Right Policing» – Tagung in Cambridge
Die «Cambridge Evidence-Based Policing Conference», die 2022 unter dem Titel «Just Right Policing» stattfand, ist jedes Jahr Treffpunkt für namhafte Fachleute aus aller Welt. Anliegen des «evidence-based policing» ist es, Daten aus der wissenschaftlichen Forschung systematisch in die alltägliche Polizeiarbeit zu integrieren.
Angewandte Forschung für zielgerichtete Polizeiarbeit
 Das Schweizerische Polizei-Institut hatte das Privileg, an der diesjährigen Ausgabe der «Cambridge International Conference on Evidence-Based Policing» teilzunehmen, die jährlich Spezialistinnen und Spezialisten für auf wissenschaftliche Erkenntnisse gestützte Polizeiarbeit (evidence-based policing, kurz: EBP) zusammenbringt. Die in den angelsächsischen Ländern weiterentwickelte EBP hat zum Ziel, die Arbeit der Polizei zu unterstützen, indem die Daten aus wissenschaftlichen Studien gezielt in diese integriert werden. Bei den Studien handelt es sich meist um randomisierte, kontrollierte Versuche, die häufig von Polizeikorps und Akademikern/-innen gemeinsam durchgeführt werden.
Das Schweizerische Polizei-Institut hatte das Privileg, an der diesjährigen Ausgabe der «Cambridge International Conference on Evidence-Based Policing» teilzunehmen, die jährlich Spezialistinnen und Spezialisten für auf wissenschaftliche Erkenntnisse gestützte Polizeiarbeit (evidence-based policing, kurz: EBP) zusammenbringt. Die in den angelsächsischen Ländern weiterentwickelte EBP hat zum Ziel, die Arbeit der Polizei zu unterstützen, indem die Daten aus wissenschaftlichen Studien gezielt in diese integriert werden. Bei den Studien handelt es sich meist um randomisierte, kontrollierte Versuche, die häufig von Polizeikorps und Akademikern/-innen gemeinsam durchgeführt werden.
Es ist kein Zufall, dass diese Tagung jährlich von der Universität Cambridge ausgerichtet wird, an der neben spezifischer Forschung über Polizeiarbeit mit dem «Master of Studies (MSt) in Applied Criminology and Police Management» auch eine einzigartige Ausbildung für in- und ausländische Polizeikader angeboten wird.
Unter der Leitung von Professor Lawrence Sherman, einem weltweit führenden Spezialisten für EBP, war die Tagung dem Thema «Just Right Policing» gewidmet. In den angelsächsischen Ländern wird die Legitimation der Polizei immer häufiger in Frage gestellt. Das Konzept des just right policing soll in diesem Kontext helfen, das richtige Mass in der Polizeiarbeit zu finden. Dank der wissenschaftlichen Forschung soll sowohl fehlende polizeiliche Präsenz, beispielsweise dort, wo die Polizei den Sicherheitsbedürfnissen in bestimmten Zonen oder gegenüber bestimmten Bevölkerungsgruppen nicht nachkommt, als auch ein Übermass an Polizeiarbeit, das etwa durch zu häufige Personenkontrollen erreicht wird, vermieden werden.
Hot spots policing, Verfahrensgerechtigkeit und Gewalt gegen Frauen
Zu den Themen der diesjährigen Ausgabe gehörte das hot spots policing, dem mehrere Studien gewidmet wurden. David Weisburd, Träger der «Sir Robert Peel Medal», stellte eine Multi-Site-Studie über die Einbindung einer Schulung zum Thema Verfahrensgerechtigkeit in Programme zum hot spots policing vor, die bezüglich Wirksamkeit und polizeilicher Legitimation vielversprechende Ergebnisse hervorbrachte.
Daneben ging es in vielen Vorträgen um Gewalt gegen Frauen, die in Grossbritannien ganz oben auf der Prioritätenliste steht. Es wurde beschlossen, eine landesweite Strategie und eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe einzuberufen, um die Prävention und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen zu verbessern.
Weitere Referate behandelten die Umsetzung einer beschleunigten Opferbetreuung bei häuslicher Gewalt durch Kontaktaufnahme über Videokonferenz oder ein Projekt zur Vorbeugung polizeilicher Fehlverhalten mithilfe eines Prädiktionstools.
(Inter-)nationale Entwicklungsperspektiven
In Grossbritannien haben die Universitäten und das «College of Policing», aber auch zahlreiche Polizeikorps für die Polizeiarbeit nützliche Forschungskapazitäten entwickelt. So verfügt die «Metropolitan Police» von London etwa über eine eigene interdisziplinäre Forschungseinheit.
Gewisse Länder wie Neuseeland, das das «New Zealand Evidence-Based Policing Centre» auf die Beine gestellt hat, haben ihre Ordnungskräfte mit EBP-Kapazitäten ausgestattet und binden wissenschaftliche Forschungsergebnisse systematisch in die operative Planung der Polizei ein. Weitere interessante Initiativen kommen aus den USA, Australien und Schweden.